Bis 2022 stehen bundesweit 511 000 geplante Unternehmensnachfolgen an. Davon sollen bereits 100 000 Unternehmen bis 2019 übergeben werden – nicht nur zeitlich betrachtet eine echte Herausforderung. Dabei kommt es nicht nur auf eine faire und vollständige Bewertung des Unternehmens an. Vielmehr erfordert die Übergabe an die nächste Generation oder einen Dritten eine langfristige und strukturierte Übergabeplanung, die Erarbeitung wohlüberlegter Handlungsoptionen und die richtige Kommunikation an Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.
Minus bei der Menge, aber ein Plus für’s Image: Obwohl die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V. (wafg) und der Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. (VDM) für die Kategorie Erfrischungsgetränke ein Minus bei der produzierten Menge bzw. beim Absatz sehen und obwohl auch die von den Autoren befragten Unternehmen einen Rückgang verzeichnen, scheint die Innovationsquote bei Süßgetränken so hoch zu sein wie lange nicht mehr.

Die Krones AG, Neutraubling, hat am Standort Freising-Attaching eine eigene Versuchsbrauerei errichtet und am 19. Juni 2018 feierlich eingeweiht. 2,6 Mio EUR hat sich das Unternehmen das Steinecker Brew Center kosten lassen. Die „außergewöhnlichste Haustrunkbrauerei Oberbayerns“ soll in Zukunft dazu dienen, die Technologieführerschaft weiter und schneller auszubauen, so Heiko Feuring, Leiter der Business Line Breweries. „Es soll Inkubator und Spielwiese zugleich sein.“ Staatsminister Dr. Florian Herrmann überbrachte seine Glückwünsche zur Einweihung.
Die deutsche Brauwirtschaft entwickelt sich positiv: Weit über 1400 Betriebe beschäftigen derzeit über 27 000 Mitarbeiter [1]. Mit ca. 95 Mio hl Bier pro Jahr bilden die deutschen Produzenten die Spitze Europas und stehen weltweit auf Rang fünf [2]. Das Bierbrauen besteht dabei aus einer Vielzahl verschiedener Abläufe, die den Standards der Lebensmitteltechnologie entsprechend umgesetzt werden müssen. Zu diesen Maßnahmen gehören sowohl Qualitäts- und Sicherheitsnormen als auch der schonende Umgang mit ökologischen und ökonomischen Ressourcen. Ebenfalls nicht zu vergessen: die Ressource der menschlichen Arbeitskraft.

Der nachfolgende Artikel fasst die zentralen Ergebnisse der Masterarbeit von Marie-Sophie Rapp an der OTH Regensburg und ihrem praktischen Betreuer und Biersommelier Klaus Artmann, Connection One, Wasserburg, zusammen. Die Thesis hat zum Ziel, mögliche Stolpersteine und Hürden auf dem bereits gesättigten deutschen Craft Bier-Markt zu identifizieren, wobei das Hauptaugenmerk auf der Herausarbeitung der Erfolgsfaktoren im Bereich Marketing und Vertrieb liegt.
Mit dem Ziel einer verbesserten Einschätzung der Filtrierbarkeit optimiert die vorliegende Arbeit eine bestehende Methode zur Isolierung von β-Glucan aus Gerstenmalz und stellt einen molmassen-definierten Standard zur Quantifizierung von β-Glucan in Würze und Bier her.
Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde der Einfluss oxidativer Abbauprodukte der Hopfenbitterstoffe in verschiedenen Biersorten sowohl bei der natürlichen als auch bei der forcierten Bieralterung sensorisch und analytisch vergleichend untersucht.
Die hygienegerechte Produktion von Lebensmitteln, Pharmaprodukten und Kosmetika erfordert eine valide, anforderungsgerechte Reinigung des Produktionsbereichs. Dabei handelt es sich häufig um komplexe Anlagen, für die eine effiziente Auslegung des Reinigungssystems eine besondere Herausforderung darstellt.
Wer kennt das nicht: Der Braumeister sagt, dass eine Edelstahlleitung neu verlegt werden muss. Aber soll man nur wegen einer einfachen Edelstahlleitung eine Firma beauftragen? Die schicken erst einen Außendienstmitarbeiter, dann wird groß geplant, Zeichnungen angefertigt – das alles kostet viel Geld.
Ein weiterer Baustein bei der Umsetzung des Anspruches „Alles, was Sie über Hopfen wissen sollten!“ ist für Dr. Elisabeth Wiesen, Technical Sales Manager bei Joh. Barth & Sohn, das neue Angebot des Hop Flavourist Course.
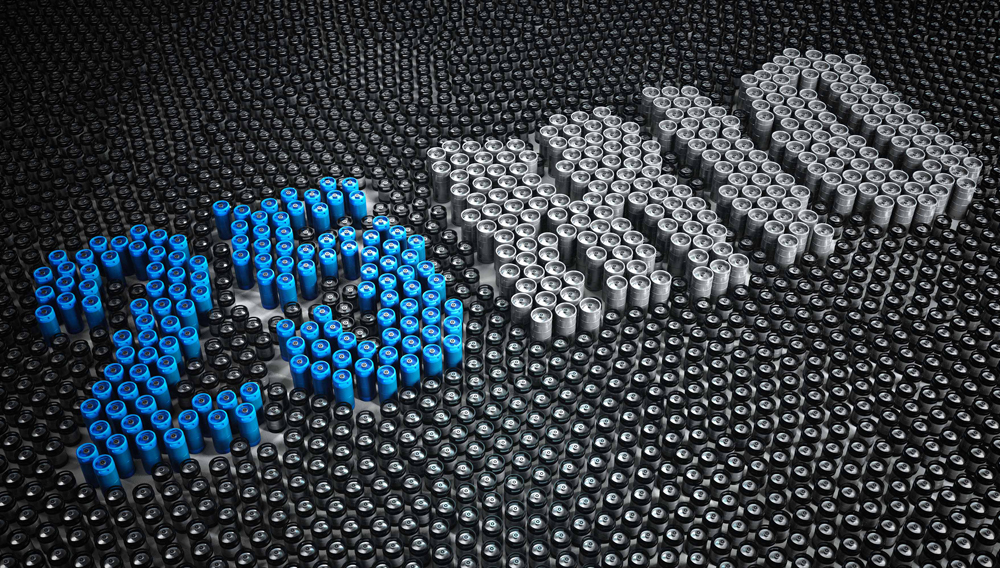
Schäfer fertigt das 25-millionste Keg. Damit festigt der Hersteller von Behältersystemen für Getränke sowie von IBC und Sonderbehältern aus Edelstahl seine Position als Innovationsführer.
Die Labom Mess- und Regeltechnik GmbH aus Hude feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde Labom 1968 von Walter Labohm. Gemeinsam mit seiner Frau Hildegard war er noch bis Mitte der 90er-Jahre geschäftsführender Gesellschafter.
Meistgelesen
BRAUWELT unterwegs
Meistgelesen
BRAUWELT unterwegs
-
Neue Mantel- und Entgelttarifverträge
Oettinger Brauerei GmbH
-
Norddeutsche Brauereien stärken Interessenvertretung
-
Größtes Umbauprojekt der Unternehmensgeschichte von Krombacher
Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG
-
Altenburger Alkoholfrei Hell
Altenburger Brauerei GmbH
-
Förderpreis geht nach Argentinien und München
BarthHaas GmbH & Co. KG


