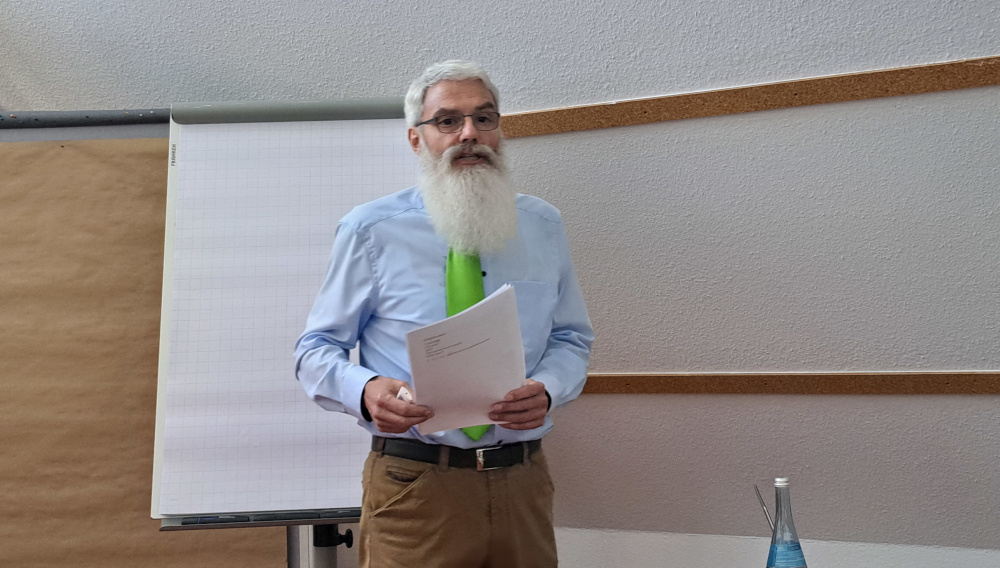Ein Update aus der Hopfenforschung
IHGC | Knapp 80 Gäste aus 17 Nationen, 33 Vorträge und 15 Poster – mit diesen Zahlen für einen wissenschaftlichen Kongress im Hopfenbau konnte Dr. Florian Weihrauch als Vorsitzender der Wissenschaftlich-technischen Kommission (STC) der International Hop Growers‘ Convention (IHGC) wahrlich zufrieden sein.
Die Tagung vom 29. Juni bis 3. Juli 2025 war seine letzte als Vorsitzender, und ein wenig Melancholie war ihm anzumerken, sind aus seiner langen beruflichen Tätigkeit im IHGC doch auch viele Freundschaften entstanden.
Bei der Suche nach dem perfekten Standort für einen Hopfenkongress war die Wahl auf die Spalter Region gefallen, wo neben dem kleinen-feinen Anbaugebiet Spalt im nicht allzu weit entfernten Hersbruck auch die weltweit wohl größten Anbauflächen für Bio-Hopfen zu finden sind, und die im Rahmen der Veranstaltung auch besichtigt wurden. Dementsprechend groß war die Resonanz: Hopfenforscher aus allen Teilen der Welt, aus Argentinien und Chile, aus den USA, aus Japan und vielen Ländern Europas, von Spanien bis Dänemark, von Belgien bis Slowenien, nutzten die Chance für die Reise nach Spalt und erlebten eine wohl organisierte Veranstaltung, bei der nur die für Mensch und Hopfen wenig zuträglichen hohen Temperaturen allen zu schaffen machten.
Das dreitägige Tagungsprogramm spannte einen weiten Bogen über alle Bereiche der Hopfenforschung hinweg. Im Mittelpunkt stand stets die Frage, wie Hopfen züchterisch oder im Anbau unter Zuhilfenahme neuester Technologien bis hin zu KI optimiert bzw. möglichst gut an den Klimawandel angepasst werden kann. Wie ist mit der zunehmenden Trockenheit in den Anbaugebieten umzugehen, oder welche Möglichkeiten zur Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen wie z.B. der Verticillium-Welke bestehen? Solche Themengebiete bildeten die Schwerpunkte.
Hops, Aroma & Beer
Für die Brauwirtschaft wurde es am letzten Tag der Veranstaltung mit dem Themenblock „Hops, Aroma & Beer“ spannend, der sich mit den braurelevanten Inhaltsstoffen des Hopfens und dem Einsatz verschiedener Hopfensorten befasst.
So untersucht Solène Dubs, Fa. Twistaroma, Frankreich, im Rahmen ihrer Promotion an verschiedenen französischen und britischen Hopfensorten, inwiefern das Anbausystem (konventionell vs. biologisch) das Mikrobiom, also die mikrobielle Zusammensetzung, im Boden und in verschiedenen Teilen der Hopfenpflanze beeinflusst und welche Auswirkungen die so gefundenen Unterschiede im Mikrobiom auf die Zusammensetzung der flüchtigen Aromastoffe u.a. in den Hopfendolden haben. Zwar ergaben ihre Untersuchungen, dass der Einfluss der Sorte auf das Mikrobiom größer war als der Einfluss des Anbausystems. Jedoch gab es bei 29 flüchtigen Aromastoffen einen signifikanten Unterschied zwischen den Anbausystemen. Bemerkenswert war das Ergebnis, dass bei biologischem Anbau mehr Inhaltsstoffe mit bekannter Wirkung gegen Pilzbefall zu finden waren. Allerdings, und wie so oft, müssen die Versuche ausgeweitet werden, da ihre bisherigen Daten für wenige ausgewählte Sorten gelten.
Andreja Čerenak, Slovenian Institute for Hop Research and Brewing, Slowenien, berichtete von Versuchen zur Eignung verschiedener slowenischer Hopfensorten für bestimmte Bierstile. Hintergrund ist die Züchtung von neun slowenischen Hopfensorten in den letzten zehn Jahren und der Wunsch, den Brauern die Wahl der Hopfensorte hinsichtlich der sensorischen Auswirkungen im Bier zu erleichtern. Mittels Bieranalysen in Kombination mit sensorischen Daten soll für jede Sorte eine Beschreibung erstellt werden, aus der ihre Eignung in Abhängigkeit vom Bierstil hervorgeht.
Auch der letzte Vortrag der Tagung ging inhaltlich in diese Richtung: Dr. Adrian Forster, HVG Wolnzach, sprach darüber, wie die Brauwirtschaft einen Weg durch das „Hopfenlabyrinth“ der vielen neuen Sorten finden könnte. Während auf der einen Seite die Notwendigkeit zur Züchtung neuer Sorten (und deren Einsatz in der Brauwirtschaft) aus den unterschiedlichen Gründen nicht wegzudiskutieren ist, sehen sich die Brauer auf der anderen Seite einer Vielzahl von Sorten gegenüber, wobei die Datenlage zu unstrukturiert und unter den Züchterhäusern zu wenig harmonisiert sei, beklagte Dr. Forster. Brauer könnten sich wegen der Komplexität der nötigen Brauversuche keinen eigenen Überblick über alle neuen Sorten verschaffen. Vergleichbare Angaben von den Züchtern beispielsweise zu agronomischen Daten, Inhaltsstoffen oder Angaben zur Nachhaltigkeit, könnten die Bereitschaft zum Einsatz moderner Hopfensorten in der Brauwirtschaft verbessern. Dr. Forster appellierte daher für eine engere Zusammenarbeit in diesem Bereich.
Neue Vorsitzende, neue Hopfenritter
In der anschließenden internen Sitzung des STC wurde Silvana Laupheimer, Deutscher Hopfenwirtschaftsverband (DHWV), als Nachfolgerin von Dr. Florian Weihrauch zur neuen Vorsitzenden des STC gewählt. Und im Rahmen des festlichen Abschluss-Dinners wurden Prof. Javier Jose Cancela, Universidad de Santiago de Compostela, Spanien, und Dr. Josef Patzak, Hop Research Institute, Žatek, Tschechische Republik, zu neuen Rittern des Hopfenordens ernannt. Ein würdiger Abschluss einer gelungenen Veranstaltung.
Schlagworte
Brauwissenschaft Hopfen Forschung Hopfenanalytik
Autoren
Lydia Junkersfeld
Quelle
BRAUWELT 2025