Giganten der Biergeschichte: Max Hayduck und Hopfenforschungszentrum Hüll
Hopfenforschung | In dieser Folge wird erstmals nicht nur eine Person, sondern auch eine Institution als „Biergigant“ gefeiert. Denn eine wesentliche Zutat, bzw. die Personen, die sich damit befasst haben, haben wir bislang nicht so recht gewürdigt: den Hopfen. Daher beginnen wir mit Max Hayduck, der zwar nicht nur Hopfenforschung betrieb, aber sehr frühe und wertvolle Impulse gab. 27 Jahre nach Hayducks Tod wurde in Hüll das Hopfenforschungszentrum gegründet. Diese Institution lässt sich nicht an einzelnen Personen festmachen. Daher gibt es hier die Ausnahme und ein Institut wird zum „Giganten der Biergeschichte“ ernannt.



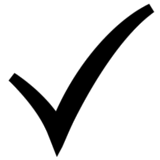 Alle Inhalte online lesen
Alle Inhalte online lesen
