Ist wirklich jeder Schluck eine Gefahr?
Gesundheitspolitik | Alkohol und Gesundheit – seit jeher ein Thema, das Politik und Wissenschaft beschäftigt. Doch nie zuvor wurde die Debatte so emotional und polemisch geführt wie heute. Die Anti-Alkohol-Kampagne der Weltgesundheitsorganisation, neue Trinkempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und Schlagzeilen der Medien heizen die Kontroverse an. Die Brauwirtschaft wehrt sich gegen die pauschale Aussage, dass jeder Schluck Bier ein Gesundheitsrisiko darstellt.



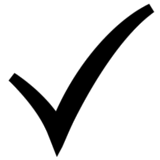 Alle Inhalte online lesen
Alle Inhalte online lesen
