Giganten der Biergeschichte: Hermann Kronseder
Maschinenbauer in der Braubranche | Wir sind in unserer Reihe mal wieder im 20. Jahrhundert angekommen. Die Quellenlage ist besser, es gibt bisweilen noch Zeitzeugen und in diesem Fall sogar eine ausführliche Autobiographie eines Mannes, der wohl der erstaunlichste und erfolgreichste Maschinenbauer, Ingenieur und Unternehmer war, den die Bier- und Getränkebranche jemals gesehen hatte: Hermann Kronseder.



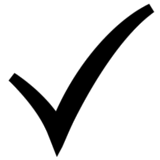 Alle Inhalte online lesen
Alle Inhalte online lesen
