Giganten der Biergeschichte: Moritz Traube und Oscar Brefeld
Die Entschlüsseler der Gärung | In der 42. Folge dieser Reihe werden wieder zwei Personen zugleich vorgestellt. Das hat mehrere Gründe: Sie waren Zeitgenossen, sie haben sich ihr Leben lang mit dem gleichen Thema befasst, und sie waren zeitweise in der gleichen Stadt aktiv. Und unbekannt sind sie den meisten von uns auch. Ihr gemeinsames, großes Thema waren die Gärung und die Hefe. Unterschiedlich waren ihre Ansätze, die Gärung zu entschlüsseln: Der Erste versuchte es auf chemischem Wege, der Zweite über die Botanik, die Mykologie.



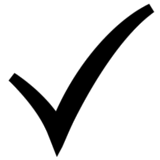 Alle Inhalte online lesen
Alle Inhalte online lesen
